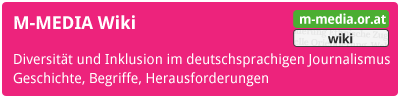Cornelia Vospernik: „Chinesen und US-Amerikaner sind sich ähnlich“


- Cornelia Vospernik, 1969 in Villach geboren, wuchs zweisprachig (Deutsch/Slowenisch) auf und besuchte das Bundesgymnasium für Slowenen in Klagenfurt. Als Redakteurin des Aktuellen Dienstes im ORF-Landesstudios Kärnten wechselte Vospernik 1996 in die Redaktion der "Zeit im Bild" nach Wien. Seit 1999 moderierte sie auch die Spät-"ZiB". Ab Jänner 2000 war Cornelia Vospernik als Auslandskorrespondentin in London, wo sie zwei Jahre das Korrespondentenbüro leitete. Von 1. Februar 2007 bis Ende 2010 war Cornelia Vospernik Büroleiterin des ORF-Korrespondentenbüros für China und den fernöstlichen Raum mit Sitz in Peking. Nach vier Jahren äußerst erfolgreicher Tätigkeit als erste Bürochefin aus Peking kehrt sie 2011 in die Zentrale nach Wien zurück, wo sie wichtige Aufgaben in der Information von ORF eins übernimmt. Die ORF-Korrespondentin wurde im Mai 2009 mit dem Concordia-Publizistikpreis 2008 und im Juni 2010 mit dem Felix Ermacora Pressepreis 2010 ausgezeichnet.
- Cornelia Vospernik: Genosse Wang fragt. Krehmayr & Scheriau, 190 Seiten, 22 Euro.
09.09.2012 | 20:33 | Marlies Kastenhofer
Cornelia Vospernik, ehemalige ORF-Auslandskorrespondentin in China und jetztige ORF 1 Nachrichtenchefin, über ihren ersten Roman „Genosse Wang fragt“, „Freunde“, Journalisten und harmlose Europäer. Die Fragen stellte Marlies Kastenhofer.
M-MEDIA: Warum haben Sie sich entschieden einen Roman zu schreiben?
Cornelia Vospernik: Ich wollte eigentlich schon immer, auch schon als Jugendliche, einen Roman schreiben. Meiner Meinung nach gibt es zwei Typen von Journalisten: Die verhinderten Künstler und die verhinderten Lehrer, was man auch an ihrer Annäherung zur Arbeit merkt. Die verhinderten Lehrer haben ein Sendungsbewusstsein und glauben, sie müssen die Welt verbessern. Die verhinderten Künstler sind eher die mit dem kreativen Ansatz. Als solche habe ich mich immer gefühlt. Ich habe aber gemerkt, dass mir sehr lange die Fähigkeit dazu gefehlt hat, einen Charakter zu erfinden, einen Charakter auszuschmücken, ihm eine Logik zu geben und dann eine Geschichte in seiner Logik funktionieren zu lassen. Das ist mir mit Wang eigentlich zum ersten Mal gelungen.
Was war der Auslöser für Sie, „Genosse Wang fragt“ zu schreiben?
Damals bin ich mit Johnny Erling bei einem Abschiedsachterl in einer Pekinger Bar gesessen. Ich fing an zu fabulieren, dass es Zeit wäre, endlich einen Roman zu schreiben. Ich fantasierte vor mich hin, einen Journalistencharakter zu erfinden und diesen mit dem zu verknüpfen, was ich lange an der chinesischen Realität erfahren habe. Dieser Journalist hat in seinem ganzen Leben keine einzige Frage gestellt, weil er in China arbeitet. Daraufhin hat mich Johnny angesehen und gemeint: „Klingt irgendwie gut! Du solltest in Genosse Wang nennen“. Mir fiel sofort der Titel zum Buch „Genosse Wang fragt“ ein. So war eigentlich der Auslöser für dieses Buch die Titelfindung. Danach fing ich an, die Geschichte zu schreiben.
Ist es nicht paradox, sich einen Journalisten vorzustellen, der ständig nach Worten ringt?
Natürlich. Allerdings können Sie mit einem glücklichen Charakter keine Geschichte füllen. Diese Handlung funktioniert sehr gut im chinesischen Setting. Genauso, wie sie in jedem anderen Setting gut funktionieren würde, in dem Journalisten nicht frei sind. Ich habe Genosse Wang einen Überbau gegeben, denn damit, nicht fragen zu können, füllt man auch kein Buch. Ich habe diesen Defekt des Nichtfragenkönnens, des Nichtverstehens, dieser Fehlkommunikation weiterentwickelt. Ich wollte eine skurrile Geschichte schreiben, vor einem chinesischen Setting, das ich kenne, mit einem Beruf, den ich sehr gut kenne.
Trägt das chinesische Mediensystem ihrer Meinung nach zur Wortlosigkeit von Journalisten bei?
Ich glaube nicht, dass die meisten chinesischen Journalisten so reflektieren, wie unser Genosse Wang. Ich habe solche und solche Journalisten kennengelernt. Geht man zu einer chinesischen Pressekonferenz, werden die Journalisten als „Freunde“ begrüßt. „Freunde“-Journalisten ist nicht unbedingt unser Berufsverständnis von Journalisten. Ich hatte den Eindruck, dass das viele nicht stört. Ich beschreibe im Buch ein paar Mal, wie die jungen Kolleginnen mit ihren Kostümchen, Schuhen und trippelnden Schrittchen beim nationalen Volkskongress auftreten. In China ist mir mehrmals aufgefallen, dass beim wichtigsten politischen Ereignis des Landes nur Jungjournalisten auftreten. Das wäre bei uns nicht der Fall. Davon kann man ablesen, dass kritisches Hinterfragen nicht wirklich erwünscht ist.
Was war Ihre prägendste journalistische Erfahrung in China?
Das ist schwer zu sagen. Aber das Erdbeben in Sichuan und die Art und Weise, wie man zugelassen hat, darüber zu berichten, war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Als ich nach China gekommen bin, habe ich zunächst eine große Öffnungstendenz erlebt, die nach den Olympischen Spielen schrittweise wieder abflaute. Es herrschte eine große Aufbruchsstimmung. Das haben alle Journalisten gespürt und das hat es so toll gemacht, dort zu arbeiten. Dabei habe ich gemerkt, wie sehr man auch manchmal gegen die Wahrnehmung im eigenen Land ankämpfen muss. In China lebt man als Journalist zwischen zwei Mühlsteinen. Der eine Mühlstein ist der chinesische Propagandaapparat oder die Behörden, die etwas nicht zulassen wollen. Der andere ist deine Heimatredaktion, die ein ganz bestimmtes Bild von diesem Land hat. Dazwischen muss austariert werden. Die Berichterstattung in Sichuan war für mich ein klassisches Beispiel dafür, dass die Erwartungshaltung im Westen eine ganz andere ist.
Als ich in China gelebt habe, habe ich noch eine andere Wahrnehmung gelernt: Bei uns läuft die Diskussion immer darüber, ob uns China überholt, ob es uns gefährden wird. Das wird von den Chinesen nicht verstanden. Sie meinen, dass sie über Jahrtausende immer führend waren. Durch die industrielle Revolution hätte der Westen sie einmal kurzfristig überholt. Doch jetzt seien sie wieder auf dem Weg, wo sie einmal waren.
Welche Stereotype existieren denn in China über Europa?
Europäer haben einen besseren Ruf als US-Amerikaner. Europa steht für alles, was erstrebenswert ist: Gute Weine, nette museale Städte, schöne Möbel, Design. Ich hatte nie das Gefühl, dass Europa als politische Gefahr wahrgenommen wird. Auch wenn sich die chinesische Regierung manchmal wünschen würde, dass ein politisches Europa als Gegengewicht zu den USA etabliert werden könnte. Als Österreicher tut man sich überhaupt leicht. Österreich wird mit dem Neujahrskonzert, Sissi-Filmen, Mozartkugeln und schönen Schlössern gleichgesetzt.
Ich glaube im Hinblick auf die USA herrscht die Angst, dass US-Amerikaner Chinesen ihr Lebensmodell aufzwingen wollen. Sie haben aber ihr eigenes Lebensmodell und zwingen es auch niemandem auf. Bei näherer Betrachtung hatte ich allerdings den Eindruck, dass US-Amerikaner und Chinesen nicht so unähnlich sind. Es sind beides große Länder, in denen wirklich viele Menschen davon überzeugt sind, dass sie die tollste Nation der Welt wären. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass der chinesische Nationalismus eingetrichtert und Folge einer Gehirnwäsche ist. Und ich glaube auch, dass die Chinesen einem US-Amerikanischen Lebensmodell folgen. Wenn man die chinesischen Städte ansieht, fällt einem die Amerikanisierung auf. Ich denke, dass das Erstrebenswerte für Chinesen der Konsum ist.
Wie geht China mit Minderheiten um?
Nach außen hin völlig gleichberechtigt. Es erinnert mich ein bisschen an meine Kärntner-Slowenische Herkunft. Der Kärntner Slowene war erwünscht, wenn er in seiner Tracht ein schönes slowenisches Volkslied in Moll gesungen hat. Als folkloristischer Faktor waren wir erwünscht, als politischer Faktor nicht. Das ist in China nicht anders. Minderheiten haben einen folkloristischen Faktor. Man sieht, dass in Regionen, wo Minderheiten die Mehrheit darstellen, sinisiert wird.
Können Österreicher von Chinesen lernen?
Was ich in China kennengelernt habe und sehr toll finde, ist dieses nicht vorhandene Selbstmitleid. Vor allem, wenn man aus einem selbstmitleidigem Land wie Österreich und aus so einer selbstmitleidigen Stadt wie Wien kommt, wo sich die Bevölkerung permanent bemitleidet. Mich hat vor allem die Landbevölkerung mit ihrem geerdeten unsentimentalen Anpacken sehr beeindruckt. Ich glaube, jeder kann sich eine Scheibe Unsentimentalität von den Chinesen abschneiden.
Wie haben Sie sich als Ausländerin in China gefühlt?
Ich habe mich eigentlich sehr toll gefühlt. Zum einen war die Auslandkorrespondenz der größte berufliche Entwicklungsschub, den ich jemals gemacht habe. Die Situation, als Journalistin ein Auslandsbüro eröffnen zu können, in ein Land zu kommen, das extrem spannend ist. Zum anderen bin ich auch menschlich extrem über mich hinausgewachsen. Für mich war es ein sehr interessanter persönlicher Prozess, in dem ich weniger über mich als Ausländerin, als über mich als Person in einer völlig fremden Kultur nachgedacht habe. Als Ausländerin bin ich in Peking extrem gut behandelt worden. Mir wurde große Freundlichkeit, bisweilen sogar überbehütete Freundlichkeit, entgegengebracht. Ich habe es bis zum Schluss meiner Zeit in China nicht ausgehalten, in Geschäften Gewand zu probieren, weil alle an mir herum gezupft haben. Es war den chinesischen Verkäuferinnen einfach nicht beizubringen, dass wir das nicht als höflich, sondern als Grenzüberschreitung empfinden. Als Journalistin konnte ich sehr schwer differenzieren, ob die Distanz, die mir entgegengebracht wurde, deswegen war, weil ich Journalistin an und für sich, weil ich westliche Journalistin, eine Frau oder zusätzlich eine Frau, die nicht wie eine chinesische Frau aussieht, bin.
Ist es gefährlich, sich offiziell als Journalist in China zu bewegen?
Ich bin nur einmal in eine Situation gekommen, in der ich mir gedacht habe, dass es für uns körperlich gefährlich wird. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass die Polizei nicht einschreitet, sondern nur dabei steht. Allerdings erlaubt man sogenannten „aufgebrachten gewöhnlichen Massen“, gegen uns vorzugehen. Das habe ich „Outsourcing von Polizeigewalt“ genannt. Einmal, als wir nach dem Erdbeben in eine Schule nach Sichuan fahren wollten, um herauszufinden, was aus ihr geworden ist, hat uns die „aufgebrachte Bevölkerung“ daran gehindert. Als Personen mit Holzlatten und halben Laternenpfählen auf meinen Kameramann und meinen Producer losgegangen sind, war es mir genug. Ich glaube aber nicht, dass westliche Journalisten in China wirklich gefährdet sind. Das ist ein falscher Heldenmut, der verbreitet wird. Die viel heiklere Frage ist, wie westliche Journalisten ihre Informanten schützen können. Man muss aufpassen, wie weit man Chinesen bei ihrem eigenen Mut unterstützt oder vor sich selbst schützt, da sie und ihre ganze Familie die Konsequenzen tragen.