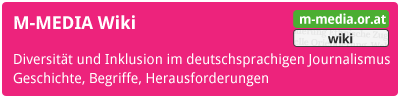Wenn Kindereien erwachsen werden: Über Stereotypen in Kinderliedern

25.11.2014 | 15:25 | Mladen Savic
Kinderreime, Kinderspiele, Kinderlieder – in der Zeit der Persönlichkeitsformung sind sie die ersten erzählerischen Formen, mit denen die Kinder als werdende kleine Menschen zusammentreffen, und zwar in einem lernförderlichen, lockeren Zusammenhang, mit Spaß und Freude, auf dem kunstvollen Weg der Sprache. Diese oft heiteren Reimsprüche, Spiele und Lieder erzählen stets eine Art von Geschichte, welche Sinngefüge und allem voran Bedeutungen schafft und auch deren Bilder, meist bleibende fürs Leben.
Aus einem solchen geistigen Reservoir schöpfen hernach die unzähligen Klassifikationen, Stereotype und kulturellen Eigenheiten, denn es ist das Urmaterial, aus dem die späteren Gedanken und Einstellungen heranwachsen, ewige Anhaltspunkte aus der Kindheit sozusagen, die sich tief in Erinnerung und Bewußtsein meißeln. Ähnlich wie bei Märchen, wo das Erzählerische erzieherisch wird, haben aber die Reime, Spielchen und Lieder bald schon keinen Erwachsenen mehr nötig, der diese Geschichte mitteilt und aufbereitet, weil die Kinder selbst sie rezitieren, miteinander spielen und vorsingen. Und wie vom Buben, der ein rettender Ritter werden möchte, bis zum Mädchen, das eine gerettete Prinzessin sein will, durchaus gesagt werden kann, daß das Märchen sie beide – sowohl in den Rollenbildern als auch in ihren Wünschen – sicherlich beeinflußt habe, so kann in einer psychologischen Ausweitung behauptet werden, daß die übrige Sphäre der kindlichen Unterhaltung ihnen einen heimlichen und daher immerwährenden Stempel aufsetzt.
Die feministische Kritik nimmt derlei Vorerziehung und ideologische Vorformung der Persönlichkeit im Dienst der bestehenden Gesellschaft zum Ausgangspunkt ihrer treffendsten Argumente. So entlarvt sie die Zuordnung von Farben zu Berufen (orange-Müllmann, weiß-Arzt) und Geschlechtern (blau-männlich, rosa-weiblich) als gesellschaftliches Konstrukt und Teil zur Erhaltung spezifischer patriarchaler Strukturen. Erziehungsform und Sprachwahl haben da jeweils eine Symbolwirkung auf den kindlichen Horziont. Die ahnungsreiche Fülle des Symbols, das bis in die geheimsten Tiefen der Seele seine Wurzeln treibt, erlaubt eine sonderbare Verbindung von Verschiedenem zu einem Gesamteindruck. Selbiger, von der Wiege an unbeschwert angelernt, fließt unbewußt in die Persönlichkeit ein und bildet in der Summe das, was man allgemein Mentalität nennt.
Von „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?!“….
In der Alpenrepublik spielt man zum Beispiel als Kind: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?!“, und selbst wenn hier nur spielerisch mit dem Schreck umgegangen wird, welchen die Kinder genießen wie die Sicherheit, daß ihnen selbst natürlich kein Übel geschieht oder nachfolgt, bedeutet das noch lange nicht, keinerlei Botschaften würden dabei vermittelt werden – Angst, wie der Titel schon besagt, hält einen zentralen Platz inne. Wäre sie unwichtig, würde sie wohl kaum genannt worden sein, am allerwenigsten im Namen selbst. Doch um sie herum, um die Frage des Fürchtens, dreht sich nun alles. Zwar ist die Bedrohung niemals real, das Gefühl allerdings, bedroht zu sein, wird auf lustige Weise und völlig unmerklich in den Geist eingeimpft und sprachlich mit einer dezidierten Farbe kodiert: die Drohung gehe von einem Mann aus, und dieser sei schwarz! Was sich sehr junge, weiße Mädchen denken werden, wenn sie zum ersten Mal einen lokalen Roma oder überhaupt einen Inder oder Zentralafrikaner erblicken, ist im Anschluß leicht zu erraten…
… zum „Drei Chinesen mit dem Kontrabaß“
Ein Werturteil wäre dennoch überflüssig. Immerhin läßt sich eine bestimmte Kultur, somit auch die germanisch alpine, nicht für ihre geschichtlich herangereiften Ausprägungen und Vorurteile pauschal verurteilen. Nicht alles in Österreich ist obrigkeitsgläubig eingefärbt, oder gar von Patriarchalismen und Rassismen durchsetzt. Das kindliche Universum läßt dort solche Eigenheit höchstens von Zeit zu Zeit erkennen. Und die Feststellung allein hat bereits ihren Wert, weit über den rein dokumentarischen hinaus. Land und Leute sind, für sich genommen, in der Alpenrepublik ebenso unterschiedlich wie sonst wo, denn Menschen bleiben überall Menschen. Auffällig ist trotzdem, daß viele Lieder dieser Landstriche einen gewissen autoritären Zug haben, nicht zuletzt jenes von den „Drei Chinesen mit dem Kontrabaß“, das heißt, von den musikalisch begnadeten Vertretern einer fremden Zivilisation, welchen zum Schluß die Polizei aufwartet mit dem kessen Sätzchen: „Ja, was ist denn das?!“ Das Ende ist offen. Den Rest kann man sich wieder denken: Ausweiskontrollen, Musiziergenehmigungen, Platzverweise, Strafzahlungen, Gewahrsam, Ausweisung, usw. Daß der Musiker, zudem ein rassisch Fremder, plötzlich zum Störenfried gemacht wird, der durch seine bloße Anwesenheit die Polizei auf den Plan ruft, umgeht man in allen Analysen dieses Kinderliedes, indem man es leichter Dinge als Unsinngedicht abtut. Damit ist die inhaltliche Dimension gestrichen und die formale grenzenlos aufgewertet: es gehe nur um austauschbare Vokale beim Singen, sagt man sehr säumig und selbstgenügsam vor sich hin. Anscheinend hätten mehr Todesfugen geschrieben werden sollen, damit die Vorsicht vor der schwarzen Milch wieder steige.
Und was ist „Ein Männlein steh im Walde“ ?
Es gibt zum Glück andere Beispiele von bekannten Kinderliedern, die eigentlich Rätsel darstellen und daher für die Heranreifenden gewitzte Denkaufgaben stellen, wie zum Beispiel jenes Lied namens „Ein Männlein steht im Walde“, dessen korrekte Deutung mit der Entschlüsselung des Männleins als Hagebutte überrascht. Der intellektuelle Wert solcher Schöpfungen ist ungemein größer als in den Beispielen zuvor; es wird nämlich kein autoritärer Charakter in den kindlichen Geist eingebettet, sprich, kein inneres Erlebnis von sadomasochistischer Symbiose mit den traditionellen Autoritäten anerzogen, wie Fromm sagen würde. Allerdings ist dieses Lied auch nicht anonym entstanden, wie der Mosaikstein einer ursprünglichen Volkskultur, welche den Intellekt ihrer Kinder pflegt und zu fördern sucht, sondern ist vielmehr privaten Ursprungs. Verfaßt worden ist es von Hoffmann von Fallersleben, der wegen seiner liberalen Weltsicht ab 1842 ständig polizeilicher Verfolgung und staatlicher Vertreibung ausgesetzt worden ist. Es scheint fast, als wäre die Suche nach Lichtblicken in der deutschsprachigen Kinderwelt ein peinlicher Weg von einem Fettnäpfchen zum nächsten.
Das wohl erschütterndste Beispiel eines literarischen Kurzwerks, das für die Kinder und ihr noch formbares Bewußtsein gedacht ist, bleibt jedoch Folgendes: „Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her! Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.“ Das bekannteste deutsche Kinderlied, 1824 von Ernst Anschütz geschrieben, ist ausgestattet mit diesen Elementen: der Fuchs (als volkssprachliches Synonym für die Schlauheit) ist der Dieb und nicht beispielsweise der Wolf (als Symbol für die mörderische Gefahr des Rudels); der Beobachter, ein Feststellender, der es imperativ beanstandet, spricht vom Jäger (als eine Art von Polizist oder Autorität mit der Lizenz zum Töten), anstatt in der Erzählung selbst ins Geschehen einzugreifen (Delegieren von Verantwortung); in sich abgerundet ist diese Geschichte durch den dynamischen Hauptinhalt (Schuld und Strafe). Schließlich dominiert darin eine Mischung aus zwei Leitmotiven – dem Fuchs also, einem Tier, das seiner Natur folgt, und dem Jäger, einem Mensch, der den gerechten Mord verüben soll, im Namen einer wiederherzustellenden Ordnung. Die sorgsam entzifferte Botschaft für die Kinder lautet demnach: das Leben gleiche einer Hauswirtschaft samt Besitz und Nutztier (daher der Gänsestall), und sein Sinn liege im Ordnunghalten mithilfe von eigens dafür bestimmter Gewalt (daher der Schießgewehrträger). In der zweiten Strophe fließt schon Blut, oder „rote Tinte“, wie es da heißt, um die Todesdrohung zu untermauern. Verstehen die Kinder auch in der Verharmlosung das Töten ganz richtig? Am Ende des Liedes steht schulmeisterlich noch ein guter Rat an Mutter Natur, sich den Schrotkugeln lieber zu beugen: „Liebes Füchslein, laß dir raten, sei doch nur kein Dieb! Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb.“ Ob der Fuchs schlau genug ist, auch das zu verstehen? Unbekümmert singen das Generationen von Kindern mit ihren Eltern und bringen ein Volk hervor, das autoritär morbid einschlägt und Hörigkeit vor den angeblichen Weisheiten der Älteren verlangt.