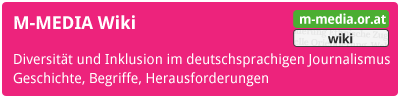Politik auf dem Fußballrasen: Kickende Legionäre

26.03.2008 | 19:27 | Ewa Dziedzic
Zara-Geschäftsführerin Barbara Liegl und Politologe Georg Spitaler über etwas andere Arbeitsmigranten.
Die Presse: Worum geht es im Projekt „Fußball und Migration“?
Georg Spitaler: Das Projekt ist zwei Jahre gelaufen – eine Aufarbeitung der Geschichte von Legionären. Grundlegend geht es darum, Geschichten über Menschen, die sehr viel zum österreichischen Fußball beigetragen haben, zu erzählen.
Barbara Liegl: Und auch darum, Fußball in einem größerem Kontext zu sehen: Wir haben uns z.B. im Vergleich die Arbeitsmigration angeschaut und einige Parallelen gefunden. Dazu zählen Fragen, die sich mit den Zugangsregeln zum Arbeits- und Fußballmarkt beschäftigen. In den letzten Jahren hat es im Fußball auch vermehrt Interventionen seitens der Politik gegeben.
Demnächst erscheint das Buch zum Projekt „Legionäre am Ball“. Was genau ist ein Legionär?
Spitaler: Der Begriff ist sehr zwiespältig. Er taucht schon in der Zwischenkriegszeit auf und bezeichnet einen Fußballer, der im Ausland sein Geld verdient. Das hatte auch negative Assoziationen, etwa im Sinn von „Fremdenlegionär“. Profis, die im Ausland angeworben wurden, gab es nach der Zwischenkriegszeit in Österreich erst wieder ab den 1960er-Jahren.
Liegl: Fußball war schon immer von Personen geprägt, die aus dem Ausland nach Österreich kamen. Genauso wie Arbeitsmigranten erfuhren Fußballer aber relativ wenig Anerkennung für das, was sie leisten. Bei Migranten werden immer andere Leistungsmaßstäbe angelegt: wenn sie nicht arbeitslos sind, dann sind sie o.k., wenn sie engebürgert wurden, dann müssen sie zum richtigen Zeitpunkt ein Tor schießen, um als „echte“ Österreicher zu gelten. Es ist also eine massive Form der Ungleichbehandlung, wenn Fußballer ihre Herkunft durch bessere Leistungen wettmachen müssen.
Sind ausländische Fußballer nicht einfach günstiger?
Liegl: Es kommt schon vor, dass die Fußballer angehalten werden, nichts über ihr Gehalt zu erzählen. Manchmal verdienen sie vielleicht mehr. Es ist wie am Arbeitsmarkt: jetzt, wo Österreich die Schlüsselkräfte fehlen, ist man auch gezwungen in manchen Branchen mit massivem Fachkräftemangel mehr zu zahlen.
Seit dem Bosman-Urteil 1995 dürfen Spieler nach Vertragsende ablösefrei den Verein wechseln. Ist Fußball heute vermehrt ein globaler Markt?
Spitaler: Fußball ist schon lange transnational. Aber seit der Regelung hat sich viel verändert. Die Spieler waren vorher von den Klubs abhängig, weil sie ohne Ablöse nicht weg konnten. Wenn du heute als Afrikaner die Möglichkeit hast, in die EU als Spieler zu kommen, heißt das aber nicht, dass die Situation nicht prekär ist.
Liegl: Deshalb gibt es mittlerweile in anderen europäischen Ländern Regelungen, wo z.B. jungen Spielern aus afrikanischen Ländern auch eine andere Ausbildung ermöglicht wird.
Ist Fußball ein politisches Thema?
Spitaler: Das Reden über Fußball ist jedenfalls politisch. Weil es um Zugehörigkeit und Definitionen, wer sind wir, wer wollen wir sein, wo gehören wir dazu, geht. Für Fans sind die Spieler auf dem Rasen wie Vertreter, die aber bestimmten Anforderungen, einem bestimmten Habitus, entsprechen müssen. Vor allem damit sie akzeptiert werden. Es gibt Zuschreibungen, wie ausländische Spieler sich präsentieren müssen.
Liegl: Zunehmend wird versucht Sport und so auch Fußball als „das Integrationsinstrument schlechthin“ darzustellen. Es fehlen hier aber die Rahmenbedingungen. Im Amateurfußball werden z.B. ausländische Mannschaften aus einem Stadion rausgeschmissen, um Platz für einheimische Sportler zu machen. Solange sich die Einstellung der Gesellschaft nicht verändert, kann auch Sport die Wirkung nicht entfalten. Und gesellschaftliche Prozesse spiegeln sich auch am Fußballplatz wieder. Für die Fans der Nationalmannschaft ist nach wie vor die Identifikation mit Österreich wichtig. Dabei wird übersehen, wie viele Nationalspieler einen Migrationsgrund haben.
Gibt es Rassismus im Fußballalltag?
Liegl: In den Gesprächen mit den Spielern selber, ist es schwierig über diskriminierende Ereignisse zu reden: Die, die nicht mehr spielen, neigen hin und wieder zur Glorifizierung der Vergangenheit. Spieler, die noch aktiv sind, sprechen nicht gerne über rassistische Erfahrungen, weil sie Angst vor Repressionen haben. Dazu kommt: über eigene Diskriminierungserfahrungen zu sprechen, macht einen selbst nochmals zum Opfer. Natürlich gibt es Beschimpfungen im Stadion und des Öfteren gibt es in solchen Situationen keine Unterstützung durch die eigene Mannschaft. Rassismus findet auch außerhalb des Stadions statt vor allem dann, wenn man nicht als Fußballer erkannt wird.
Spitaler: Auf der symbolischen Ebene hat sich etwas getan. Spieler und Vereine treten zunehmend gegen Rassismus auf. Sie haben erkannt, dass ihnen das nicht schadet. Man kann aber noch immer fragen: Was bringt das alleine? Wenn man sich nämlich die strukturelle Ebene, etwa den Ausschluss von Migranten aus den Vereinsetagen anschaut, gibt es noch viel zu tun.
Zum Abschluss: Ist Fußball die letzte Männerbastion?
Liegl: Schon die Arbeitsmigration war männlich dominiert. Die Frau ist nicht als Arbeitskraft gekommen, sondern im Rahmen des Familiennachzugs. Das Fremdenrecht hilft den Frauen nicht aus der Abhängigkeit heraus. Das hat weit reichende Auswirkungen: Frauen können nicht sofort arbeiten und sich auch nicht scheiden lassen, so lange sie vom Aufenthaltstitel ihres Mannes abhängig sind. So gibt es Rollenbilder, die im Zuge der Migration verstärkt werden. Die Strukturen werden also durch die Rahmenbedingungen festgeschrieben: auch im Fußball. (EWA AGATA DZIEDZIC UND MEROPI TZANETAKIS )